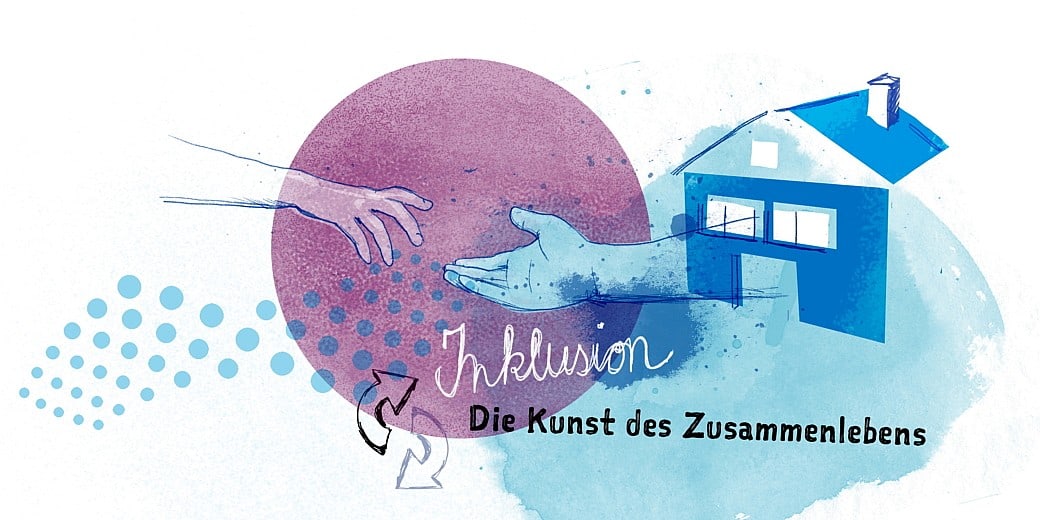Wozu ein Aktionsplan?
Inklusion ist nicht etwas, was wir als Kirche auch noch machen, sondern was uns ausmacht. Teilhabe ermöglichen für arme, arbeitslose, psychisch kranke und alte Menschen, für Menschen mit Behinderung oder für Flüchtlinge ist ein ureigenes Anliegen von Kirche. Inklusion wird in Kirchengemeinden, in kirchlichen und diakonischen Einrichtungen vielfach gelebt. Wir können es jedoch noch systematischer und bewusster tun. Dazu will der Aktionsplan ‚Inklusion leben‘ anregen. Es ist der Versuch, miteinander einen vielfältigen Prozess bis 2020 zu gestalten. Landesbischof Dr. h. c. Frank Otfried July
Der Aktionsplan will Kirchengemeinden, kirchliche Werke und diakonische Einrichtungen darin bestärken, die Inklusion von Menschen mit eingeschränkten Teilhabemöglichkeiten systematisch zu fördern und vor Ort konkrete Schritte zu formulieren und umzusetzen. Im Zentrum stehen Impulse zur Entwicklung eigener inklusionsorientierter Prozesse. Sie sollen auch dazu beitragen, Haltungen und Einstellungen zu reflektieren und die sozialräumliche Vernetzung zu stärken.
Menschenrechte als Grundlage
„Alle Menschen sind gleich an Würde und Rechten geboren“, formuliert Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vom 10. Dezember 1948. In Artikel 2 wird festgehalten, dass alle Menschen ohne jeden Unterschied den gleichen Anspruch auf die aufgeführten Rechte und Freiheiten haben, darunter auch das „… Recht am kulturellen Leben der Gesellschaft frei teilzunehmen …“ (Artikel 27). Die Vereinten Nationen haben diese allgemeinen Menschenrechte unter anderem für zwei Personengruppen konkretisiert und in einem „Übereinkommen“ bzw. einer „Konvention“ jeweils durch buchstabiert, wie sie umzusetzen sind.
Am 20. November 1989 wurde die „Konvention über die Rechte des Kindes“ verabschiedet und am 26. Januar 1990 von der Bundesrepublik Deutschland ratifiziert. Sie legt weltweit gültige Standards fest, um Kindern das Überleben zu sichern, eine gesunde Entwicklung zu gewährleisten und sie vor Diskriminierung, Vernachlässigung und Missbrauch zu schützen.
über die Rechte von Menschen mit Behinderung“ vom 13. Dezember 2006, das am 29. März 2009 von der Bundesrepublik Deutschland ratifiziert worden ist, fordert für Menschen mit Behinderung in Artikel 3c „die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und Einbeziehung in die Gesellschaft“ („full and effective participation and inclusion in society“). Ihre Beeinträchtigungen, so heißt es in Artikel 1, werden oft erst durch „Wechselwirkungen mit verschiedenen Barrieren“ in ihrer Umwelt zu Behinderungen. Diese gilt es deshalb in allen Bereichen des Lebens, Arbeitens und Wohnens konsequent abzubauen.
Das Recht auf Teilhabe hat auch das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil zur Zusammensetzung des Hartz-IV-Regelsatzes vom 9. Februar 2010 unterstrichen. Ein „menschenwürdiges Existenzminimum“ beinhalte mehr als nur die Sicherung der physischen Existenz. Dazu gehöre auch, dass es ein „Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben umfasst, denn der Mensch als Person existiert notwendig in sozialen Bezügen.“ Materiell arme Menschen sollten so viel zum Lebensunterhalt erhalten, dass auch sie am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Dies sei mit Bezug auf Artikel 1 des Grundgesetzes eine Frage der Menschenwürde.
Gesellschaftliche Ausdifferenzierungen sind immer mit einem Wechsel von Inklusion und Exklusion verbunden. Das ist als solches noch kein Problem. Bei den Berliner Philharmonikern kann nicht jede und jeder mitspielen. Exklusionen werden jedoch dort problematisch und zu einer Frage von Menschenwürde und Menschenrechten, wo sie mit gesellschaftlicher Ausgrenzung, sozialer Ungleichheit und Diskriminierung verbunden sind. Dann stehen sie dem Menschenrecht auf Teilhabe am Leben der Gemeinschaft entgegen.
Inklusion in einem weiten und umfassenden Verständnis zielt auf die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen am Leben der Gemeinschaft. Dies erfordert eine breite gesellschaftliche Reflexion von Haltungen und Einstellungen, eine Sensibilisierung für Barrieren und entsprechende strukturelle Änderungen, um Teilhabe zu ermöglichen. Dies verlangt nichts weniger als einen Kulturwandel durch systemische Veränderungsprozesse auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Kirche und Diakonie sind hier verpflichtet, ihren Beitrag zu leisten.
PDF Download
Theologische Hintergründe
Schöpferische Vielfalt
Gottes schöpferisches Handeln bringt eine erstaunliche Vielfalt hervor. Davon erzählen die Schöpfungsgeschichten. Der Mensch wird erschaffen als Mann und Frau. Als solche sind sie gesegnet (1. Mose 1, 26-28). Die Vielfalt der Völker ist von Gott gewollt und in Abraham gesegnet (1. Mose 10, 12,3). Auch Pflanzen und Tiere werden geschaffen „ein jedes nach seiner Art“ (1. Mose 1,12.24). Das Leben auf dieser Erde entwickelt sich in einer bunten Vielfalt.
Der Mensch als Ebenbild Gottes
Der Mensch wird als Ebenbild Gottes geschaffen (1. Mose 1,27). Darin gründet seine unantastbare Würde. Sie schützt ihn vor Festlegungen und Zuschreibungen jeder Art, vor Abwertungen und Diskriminierung. Sie ist eine unverfügbare Gabe Gottes. Sie muss nicht durch Leistung verdient werden. Sie ist ein Geschenk.
Doch die Ausdifferenzierung gesellschaftlichen Lebens ist immer wieder mit Abwertungen und Ausgrenzungen verbunden. Das erfahren arme und arbeitslose Menschen, Menschen mit psychischer Erkrankung oder Behinderung, Fremde und Flüchtlinge immer wieder. Deshalb erinnert das „Buch der Sprüche“ an die Würde der Armen: „Wer dem Geringen Gewalt antut, der lästert dessen Schöpfer; aber wer sich des Armen erbarmt, der ehrt Gott“ (Sprüche 14,31). Das Gleichnis vom Weltgericht gibt zu bedenken, dass uns in Armen, Kranken und Fremden Christus selbst begegnet (Mt. 25,31–46).
Ausgrenzung überwinden, Teilhabe ermöglichen
Von Ausgrenzung betroffene Personengruppen stehen deshalb unter dem besonderen Schutz Gottes: „Der Herr behütet die Fremdlinge und erhält Witwen und Waisen“ (Psalm 146,9). Die Bibel rückt sie immer wieder in den Blick. „Wenn dein Nächster neben dir verarmt und sich nicht mehr halten kann, so sollst du ihn unterstützen, auch einen Fremden und Halbbürger, damit er neben dir leben kann“ (3. Mose 25,35). Sie sollen mit leben und am gemeinschaftlichen Leben teilhaben können. So sollen Feste gemeinsam mit Fremden, Witwen und Waisen gefeiert werden (5. Mose 16,9–15).
Jesus wendet sich ausgegrenzten Menschen in besonderer Weise zu. Mit Zöllnern und Sündern setzt er sich zu Tisch (Mt. 9,9–13). In seinen Gleichnissen kommen arme und ausgebeutete Kleinbauern, Tagelöhner und arbeitslose Menschen in den Blick (Lk. 16,1–9; Mt. 20,1–16). Er nimmt Menschen mit Behinderung, seelischen oder körperlichen Erkrankungen wahr. Blinde, Gelähmte, Aussätzige, seelisch gekrümmte und geplagte Menschen finden bei ihm Gehör. Er holt sie vom Rand in die Mitte, zurück ins Leben der Gemeinschaft (Joh. 5,1–9; Lk. 13,10–17; 18,35–42). Das vorherrschende Denken in Abgrenzungen durchbricht Jesus immer wieder. Beim verachteten reichen Zachäus kehrt er ein (Lk. 19,1–10). Ein Samariter, ein Andersgläubiger, wird zum Vorbild gelebter Nächstenliebe (Lk. 10,25–35).
Für Paulus ist die christliche Gemeinde „Leib Christi“. Sie steht vor der besonderen Herausforderung mit der Verschiedenheit von Reichen und Armen, Starken und Schwachen, Angesehenen und Verachteten umzugehen (1. Kor. 1,26–29). Immer wieder gibt es Spaltung und Ausgrenzung. Paulus tritt diesen entschieden entgegen. Wer getauft ist, gehört dazu. Als Verschiedene gehören wir zusammen: „Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie“ (1. Kor. 12,13).
Beim Abendmahl in Korinth haben Reiche üppig gespeist und Arme saßen hungrig daneben. Paulus kritisiert das. Denn das Abendmahl ist für ihn in besonderer Weise ein Zeichen der Gemeinschaft mit Christus und untereinander. Hier soll sichtbar werden, dass alle dazugehören und bei aller Verschiedenheit gleiche Würde haben (1. Kor. 11,17–34). Es ist das Leitbild einer inklusiven Kirche: „Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt einer in Christus“ (Gal. 3,28).
Den christlichen Gemeinden der ersten Jahrhunderte kam es auf die Einheit von martyria (Zeugnis), leiturgia (Gottesdienst), diakonia (Dienst am Nächsten) und koinonia (Gemeinschaft) an. Als feiernde und diakonische Gemeinden waren sie missionarische und wachsende Gemeinden, berichtet die Apostelgeschichte (Apg 2,41–42; 6,1–7).
Die zwiespältige Geschichte der Kirche
Die Kirchen haben in beeindruckender Weise immer wieder Grenzen überwunden und Inklusion gelebt. Sie haben aber auch oft in ihrer Theologie und ihrer Praxis Abwertungen und Ausgrenzungen Vorschub geleistet. Armen und Arbeitslosen wurde immer wieder die Schuld an ihrer Situation zugeschoben, anstatt deren Ursachen zu bekämpfen, Krankheit und Behinderung wurden bis ins 20. Jahrhundert als Strafe Gottes interpretiert, Frauen die Gleichberechtigung verwehrt, sie wurden von Ämtern ausgeschlossen, Menschen anderer sexueller Orientierung ausgegrenzt.
Die Zwiespältigkeit im Denken und Handeln zeigt sich auch an großen Persönlichkeiten wie Martin Luther. Er hat sich zum Beispiel in vorbildlicher Weise für die Teilhabe armer und arbeitsloser Menschen am kirchlichen und gesellschaftlichen Leben eingesetzt, aber Behinderung als Werk des Teufels gesehen. Solchen Vorstellungen tritt in unserer Zeit der Theologe Ulrich Bach, selbst seit seiner Studienzeit im Rollstuhl, entgegen. Er kritisiert den „Sozialrassismus in Kirche und Theologie“ gegenüber Menschen mit Behinderungen und fordert ein grundlegendes Umdenken im Menschenbild, indem Trennungen und Abgrenzungen aufgehoben werden: „Menschen mit und ohne Behinderung: beide jeweils so von Gott geschaffen, … beide durch Christus mit Gott versöhnt, … beide auf andere angewiesen, beide mit göttlichen Gaben begabt, beide auf Erlösung wartend.“
In diesem Sinne gilt es auf dem Weg zu einer inklusiven Kirche
- trennende Denkmuster aufzulösen
- Andersartigkeit von Menschen zu respektieren und
- den Umgang mit Verschiedenheit zu lernen.